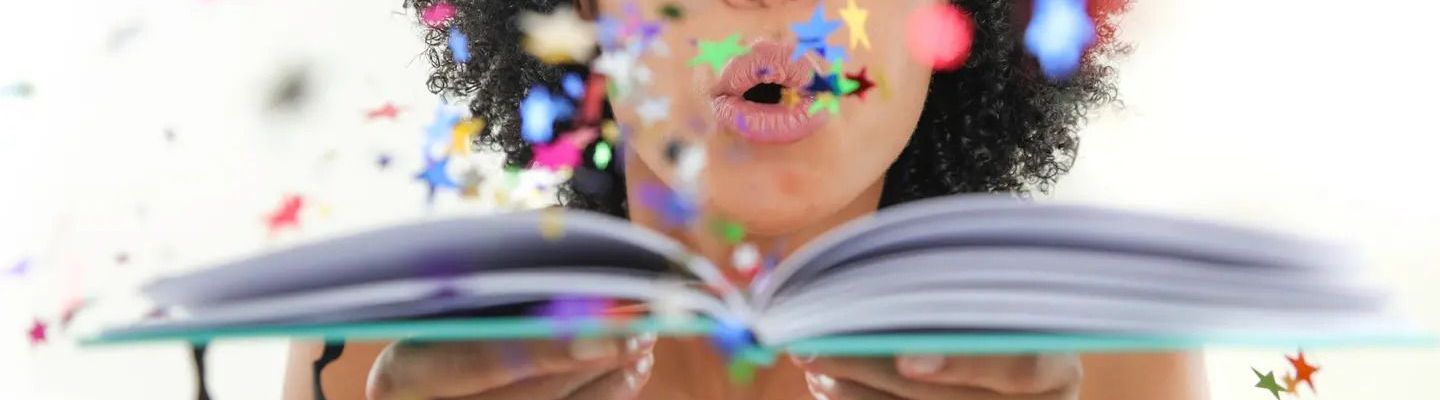
Aktive
So nennt man diejenigen, die auf der Bühne stehen und reden, singen oder tanzen.
Altweiberfastnacht
Eigentlich nur „Weiberfastnacht“, die ursprünglich ab Bingen rheinaufwärts keine Tradition hatte, vor wenigen Jahren aber auch in Mainz am Donnerstag vor Fastnacht „eingeführt“ wurde.
Amtskette (Präsidentenkette)
Solche Ketten tragen Amtsträger wie Präsidenten, auch Komitee-, Elferrats-, Senats- und Sitzungspräsidenten karnevalistischer Gesellschaften, bisweilen auch bei den Vorsitzenden vereinsübergreifender Organisationen, z. B. dem obersten Chef eines ganzen Rosenmontagszuges.
Eines haben diese Amtsketten in der Regel gemeinsam: Das Mittelstück der Kette bleibt je nach Amt des Trägers dem Logo bzw. Wappen des Vereines, der Organisation oder der Stadt vorbehalten.
Die weiteren Kettenglieder bestehen häufig aus zwei sich abwechselnden Elementen, einmal ein „festes“ Karnevalsymbol (z.B. Narrenkappe) und ein Element mit leerem Feld für individuelle Gestaltung.
Aschermittwoch
„Am Aschermittwoch ist alles vorbei!“ In der Tat! Dieser 46. Tag vor dem Osterfest ist der Beginn der Fastenzeit, an dem die katholische Kirche mit dem Aschenkreuz die Gläubigen an ihre eigene Endlichkeit erinnert: Mementomori! – „Denke daran, dass Du sterblich bist“. Dieser Tag hat mit der Zeit Rituale wie z.B. Heringsessen, Beerdigung der Fastnacht und Geldbeutelauswaschen ins Leben gerufen, die jedes Jahr zelebriert werden.
Brauch
„Wissenschaftlich versteht man darunter eine rituell genormte, regelmäßig wiederkehrende und von gemeinschaftlichem Geist geprägte Handlung, die durch Tradition gefestigt ist und einen Bedeutungsgehalt hat".
Bund Deutscher Karneval (BDK)
Vereinigung zur Pflege fastnachtlicher Bräuche. Der BDK besteht aus 35 Regionalverbänden bzw. Fachausschüssen mit über 5.000 Vereinen und Gesellschaften. Er wurde am 24. Oktober 1953 im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz wiedergegründet (Erstgründung 1937).
Bütt
Ihrer Herkunft nach, ist die Bütt ein halbes, nach hinten geöffnetes Weinfass. Im Laufe der Zeit hat man der Bütt das Aussehen einer Eule gegeben. Die Eule ist zum einen der Vogel der Weisheit, zum anderen das Markenzeichen für die Narrenfigur "Till Eulenspiegel". Eine andere Bezeichnung für die Bütt ist die „närrische Rostra“.
Büttenrede
Das ist eine vorgetragene Rede. Sie ist häufig gereimt und wird von der Bütt aus im lokalen Dialekt vorgetragen, gerne auch als Versprecher mit Witz. Der Kokolores-Vortrag dient der Unterhaltung des Publikums und greift Alltagssituationen satirisch auf. Der politisch-literarische Vortrag versteht sich stets als
"gekonnte Kritik"; mehr als reines Politisieren.
Carneval
Ursprünglich wurde “Karneval” mit C geschrieben und setzt sich aus den lateinischen Wörtern “carnis” (Fleisch) und “levare” (wegnehmen) zusammen. Der Grund dafür ist die Fastenzeit, in der man kein Fleisch essen durfte.
Deutsches Fastnachtmuseum Kitzingen
Es ist eine gemeinnützige Stiftung des Bundes Deutscher Karneval. Unter seinem Dach befinden sich rund 4.000 Karnevalsvereine, Narrenzünfte und Faschingsgilden. Nach der Gründung 1963 in Kitzingen am Main wurde 1966 zunächst eine Ausstellung im historischen Falterturm eröffnet. 2001 kam ein Haus in der Rosenstraße hinzu. Dort ist jetzt ein Erweiterungsbau geplant. Die Sammlung zeigt "Fastnacht im Spiegel der kulturgeschichtlichen Entwicklung" - eine wissenschaftlich fundierte Dokumentation des Karnevals im deutschsprachigen Raum. Ferner befindet sich im Kitzinger Marktturm das Zentralarchiv der Deutschen Fastnacht und die Europäische Dokumentationszentrale für Fastnacht-Brauchtum.
Elferrat
Der Elferrat besteht meist ausschließlich aus Männern. Allesamt geschickte Entertainer. Sie tragen häufig glitzernde Gewänder und spitze Mützen. Manchmal sind auch Frauen zu gelassen. Ihnen fällt dann meist die Rolle der “Ratgeberin“ zu. Als organisatorisches Gremium übernimmt dieser exklusive Zirkel verschiedene Aufgaben und unterstützt den Präsidenten tatkräftig. Zum Beispiel bei der Organisation und Durchführung von Sitzungen oder Umzügen. Vor allem obliegt es ihnen, das geheime Wissen und die Traditionen des Karnevals zu hüten. Sie pflegen Rituale und lassen die Fastnacht zu einem unvergesslichen Spektakel werden.
Während der jeweiligen Prunksitzungen thront der Elferrat auf der Bühne “über“ den Darbietungen von Büttenrednern, Tänzerinnen und Musikkapellen.
Elfter Elfter (11.11)
Der 11. November, beziehungsweise St. Martinstag, gilt als Auftakt der Fastnachtszeit.
Fastnacht
Die Fastnacht hat ihre Ursprünge im Mittelalter und in der frühen Neuzeit und bezeichnet das Schwellenfest vor der Fastenzeit. Damals wurden die Speisen und Lebensmittel vertilgt, die in der darauffolgenden 40-tägigen Fastenzeit strengstens verboten waren, zum Beispiel Fleisch, Fett, Eier, Alkohol. Die Metzger mussten nochmal eine Gelegenheit bekommen, ihre Waren vor der Fastenzeit unters Volk zu bringen. So wurde noch einmal ausgiebieg gegessen, getrunken und gefeiert. Da der Begriff "Fastnacht" auch mit "die Nacht vor dem Fasten", übersetzt werden kann, findet von Fastnachtsdienstag auf Aschermittwoch die eigentliche Fastnacht statt (wenn man es historisch genau nimmt).
Garden
Die Garden sind ursprünglich als Persiflage auf das Militär entstanden. Die Uniformen, die Dienstränge und das Zeremoniell nehmen militärisches Gehabe auf die Schippe: vom einfachen Soldaten bis zum General, vom morgendlichen Appell bis zum abendlichen Zapfenstreich, von der Rekrutenvereidigung über Regimentsfahnen bis zur Militärmusik, vom Feldlager bis zur Abhaltung von Paraden. Die Garden hatten früher eine wichtige Ordnungsfunktion und sind bis heute mit den Musik- und Fanfarenzügen ein tragender Bestandteil der Straßenfastnacht.
Gardetanz
Der Gardetanz ist im Karneval ein Tanzsport, der Kraft und Flexibilität mit Tanzen verbindet. Die Tradition des weiblichen Gardetanz begann im 20. Jahrhundert und ist an Revue-Tänzerinnen der 1920 Jahre angelehnt. Zuvor waren alle Tänzer innerhalb der Garde männlich. Im Fokus steht meist das “Solo“. Häufig eine sehr junge, aber besonders talentierte Tänzerin. Um die akrobatischen Leistungen zu erbringen, trainiert die Gruppe das ganze Jahr über. Männliche Gardetänzer übernehmen häufig die wichtige Aufgabe, die Tänzerinnen in Menschenpyramiden nach oben zu katapultieren und wieder aufzufangen.
Gutsjer / Kamelle
Meint die Bonbons, die bei den Fastnachtsumzügen von Fußgruppen unter den mitfeiernden Zuschauern verteilt werden. Außerdem zählen sie auch zum Wurfmaterial, das z.B. von den Umzugswagen geworfen wird.
Früher waren es hauptsächlich Karamellbonbons, was den zweiten Namen erklärt. Heutzutage wird aber allerlei Süßkram verteilt bzw. geworfen.
Helau
Ursprünglich verlieh man in Mainz närrischer Begeisterung durch “Hoch”- oder “Hurra”-Rufe Ausdruck, praktisch jeder, wie und was er wollte. 1934 brachten Delegationen von Mainzer Vereinen vom Besuch in Düsseldorf den dort üblichen närrischen Schlachtruf “Helau” mit.
Kampagne
Der Jahreszeitraum, in dem die Veranstaltungen stattfinden. Sie beginnt mit dem 11.11 und endet am Aschermittwoch. Die Fastnachtsvereine stellen jede Kampagne unter ein besonderes Motto.
Komitee
Ein anderes Wort ist der Elferrat. Die elf Komiteeter/innen haben ihren Platz auf der närrischen Regierungsbank – während der Sitzung – auf der Bühne.
Konfetti
Bunte Papierschnipsel, die in Stanzmaschinen angefertigt werden und mit Konfettikanonen viele Meter weit geschossen werden. Bei den Umzügen bestehen die Schnipsel häufig aus Folie oder Seidenpapier, denn das schwebt länger durch die Luft.
Kreppel
Ein Fettgebäck aus süßem Hefeteig mit Füllung (meist Konfitüre).
Es ist das traditionelle Gebäck zu Silvester und Karneval (bevorzugt am Rosenmontag und Karnevalsdienstag). Je nach Kampagne gibt es “Kreppel“ mit Eierlikör, Schokosoßen- oder Vanillepuddingfüllung. Wer mag darf auch Eierlikör-Zuckerguss darauf genießen.
In einigen Regionen ist es Sitte (z.B. zu Silvester), einzelnen Exemplaren eine “besondere“ Füllung wie z.B. Senf oder Zwiebeln zu geben. Wer ein solches Exemplar erhält, dem stehe viel Glück im neuen Jahr bevor. Manche Dame soll auch schon ihren Verlobungsring darin gefunden haben.
Luftschlangen
Vielleicht das typischste Fastnacht-, Silvester- und Partyzubehör, diese farbigen, in einem komplizierten Spezialverfahren von Aussparungsmessern perforierten, anschließend gerollten und endverklebten Streifen, die meist aus Papier, manchmal auch aus Folienmaterial produziert werden und angeblich wie die Konfettis von dem Berliner Paul Demuth erfunden wurden, wobei Folienluftschlagen nach dem Ausrollen die Spiralform schlechter behalten als die Papierkollegen.
Luftschlagen entrollen sich durch Hineinblasen in die Rollenmitte, wobei lt. Studien ein Abstand von 25-30 Zentimeter zwischen Lippen und Luftschlange ideal sein soll. Echte Insider entrollen eine Luftschlange aber durch Werfen: Sie ziehen aus der Innenseite der Rolle das Materialende einige Zentimeter heraus, klemmen diese zwischen Ringfinger und kleinen Finger, fassen die Rolle (ohne sie zu zerdrücken) mit Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger und werfen die Rolle gezielt in die Wunschrichtung, ohne dabei das eingeklemmte Ende loszulassen. So umständlich dies auch klingen mag, so einfach ist’s mit ein wenig Übung.
Mucker & Philister
Mucker & Philister sind Miesepeter, Stimmungskiller und Nörgler.
Narr
Jemand der in der Fastnacht gerne Späße macht. Jeck (Kölner Karneval) ist eine andere Bezeichnung dafür.
Narrenkappe
Mit der “Kapp” demonstrierten die Narren traditionell Außenstehenden ihre Gleichheit und Eintracht; gleiche Brüder – gleiche Kappe.
Narrhalla
Nennt man den Versammlungsort der Narren, bspw. Räumlichkeiten, in der Sitzungen stattfinden. Den Namen „Narrhalla“ trägt aber auch die älteste noch existierende Narrenzeitung; gegr. 1841.
Narrhallamarsch (Ritzamba)
Der Narrhallamarsch hat keinen feststehenden Text; es spielt die Musik die zentrale Rolle und begleitet des Weiteren den Ein- und Ausmarsch der Büttenredner. Er ist bereits seit 1840 musikalischer Teil von allen Variationen des Fastnachtstreibens.
Orden
Eines der Gründerziele war es, das lange Zeit dem Adel und dem Militär vorbehaltene Ordenswesen, zu persiflieren. Heute sehen Orden wieder aus wie Orden und sind teilweise sehr begehrte Schmuckstücke. Der aktive Narr bedauert, dass es Pseudo-Fastnachter gibt, die mit allen Tricks versuchen, so viele der begehrten Orden abzustauben wie möglich, ohne Nachweis fastnachtlichen Tuns und verurteilt dies, denn nur wer das Brauchtum Fastnacht durch persönlichen Einsatz unterstützt hat den Orden „verdient“. Deshalb bleibt der aktive Narr vom ideellen Wert seines redlich verdienten Ordens überzeugt.
Protagonist
Das ist der Held eines Werkes und die Hauptrolle in einer Erzählung – der Redner, Hauptdarsteller, der im Laufe seiner Erzählungen eine Entwicklung zum Positiven durchläuft. Er ist ein Vorkämpfer, Ideengeber und eine Leitfigur.
Rosenmontag
Der Höhepunkt der Fastnachtszeit wird mit dem Umzug am Rosenmontag zelebriert, der um 11.11 Uhr beginnt. Wie der Rosenmontag zu seinem Namen kam, ist bis heute nicht final geklärt. Die geläufigste Erklärung ist folgende: Im 11. Jahrhundert soll der Papst am Rosensonntag eine goldene Rose geweiht haben. So leitete sich der Name auch für den Montag ab.
Schunkeln
Geschunkelt wird vor allem während der Fastnacht aber auch zur Volksmusik. Schunkeln stärkt die Gemeinschaft, niemand wird ausgegrenzt. Wichtig dabei: Dass alle in dieselbe Richtung schunkeln. Bei langen Sitzreihen ist das nicht immer einfach.
Sitzungspräsident
Die Sitzungspräsidenten nehmen im Elferrat den Platz in der Mitte ein und führen durch die Veranstaltung. Oft mit gereimten Texten, aber auch in lockerer Form begrüßen sie, überreichen Orden und Blumen. In der Kappensitzung des LCV gab es in 59 Jahren zehn Sitzungspräsidenten:
- 1967-1968 Wilhelm Reinhardt
- 1969 Ludwig Jung
- 1970-1971 Dieter Dörr
- 1972-1974 Karl Greim
- 1975-1977 Helmuth Nold
- 1978 Karl Greim
- 1979 Helmuth Nold
- 1980-1981 Karl Greim
- 1982-1985 Helmuth Nold
- 1986-1991 Albert Müller
- 1992-1996 Klaus-Dieter Jung
- 1997-1999 Andreas Wiesenäcker
- 2000-2015 Horst Reinhardt
- seit 2016 Patrick Fiederer
Tusch
Ein musikalisches Element, das die Zuschauer zum Applaus auffordert oder die Pointe einer Büttenrede oder eines Witzes zeigt.
Uniform
Die traditionelle Kleidung vieler Karnevalsvereine, oft mit bunten Accessoires.
Vierfarbbunt
Das sind die Fastnachtsfahnen in der Reihenfolge Rot, Weiß, Blau, Gelb. Nachweisbar schon seit 1838, aber oft noch in verschiedener Reihenfolge, im närrischen Einsatz. Wie die endgültige Farbkombination zustande kam ist bis heute unklar.
www (närrisch)
Weck, Worscht und Woi
Verkleidung
Die Kostüme, die Narren während der närrischen Tage tragen, um ihre Identität zu verbergen oder in andere Rollen zu schlüpfen.
Zepter
Das Zepter war seit jeher neben Krone und Reichsapfel ein Zeichen der Herrschaft und Macht.
Im Karneval wird das Zepter vorwiegend von den Prinzen mitgeführt, aber auch Sitzungspräsidenten tragen bei den Einzügen Zepter. Zepter werden lt. alter Tradition grundsätzlich in der rechten Hand getragen und im Fall eines nötigen Händedruckes kurzfristig an ein Elferratsmitglied übergeben, niemals in die linke Hand!
Meistens ist im Zepterkopf das Logo des Vereines oder der Stadt abgebildet. Und so schön es auch aussieht, eine Gefahr birgt das Zepter: Wenn man es unbeobachtet am Tisch liegen läßt, wird es schnell abhanden gekommen sein und die Auslösung kann teuer werden!!!